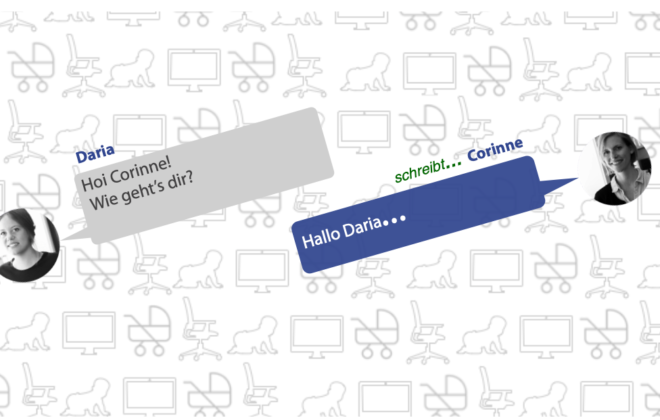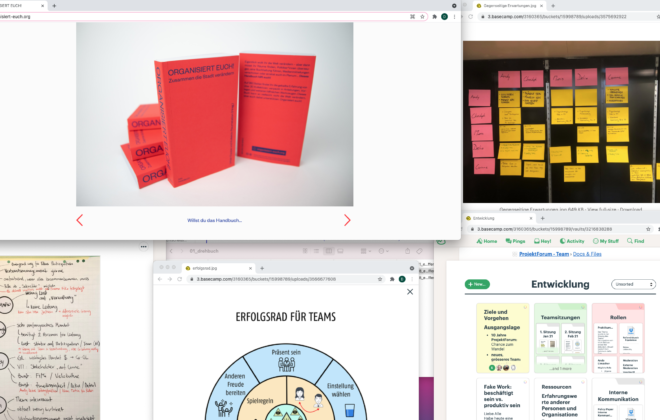Von anregend bis anstrengend: Über eine Familienreise mit Teilzeit-Fernarbeit.
Unser Teammitglied Andy Limacher war neun Monate lang unterwegs und arbeitete mit einem reduzierten Pensum im Hintergrund von ProjektForum. Nachträglich nennt er das eine «Familienreise mit Teilzeit-Fernarbeit». Ein Artikel über eine lehrreiche Zeit und förderliche Faktoren.
Einordnung, Einschätzung und Erfolgsfaktoren.
Ob die Familienreise mit Teilzeit-Fernarbeit gelingt, hängt stark von der Tätigkeit und dem Arbeitspensum der Erwachsenen, dem Alter und der Anzahl der Kinder und nicht zuletzt vom Temperament, dem Zusammenspiel und der Belastbarkeit aller Beteiligten ab. Darum hat dieser Artikel keinen Anspruch, allgemeingültige Tipps zu geben: Ich versuche lediglich eine Einordnung unserer persönlichen Erfahrungen sowie eine Einschätzung, was zum Gelingen der Teilzeit-Fernarbeit beitragen kann.
Für eine erste Einordnung sei dargelegt, dass wir zwei Erwachsene Anfang Vierzig und ein Kind Anfang Vier sind. Als erste Einschätzung sei ergänzt, dass wir das Experiment zwar als gelungen betrachten, die erhoffte kreative Explosion in exotischer Umgebung allerdings ausgeblieben ist. Zumindest in meiner Realität war die Fernarbeit zwar durchaus anregend, aber aus verschiedenen Gründen oft auch anstrengend. Konkret: Sich an immer neuen Orten die nötige Zeit und ein funktionierendes (und im besten Fall auch ein inspirierendes) Arbeitsumfeld für unterschiedliche Aufgabenstellungen zu schaffen, war letztlich aufwändiger als gedacht.
Leidenschaft, Segen und Fluch.
Unsere letzte mehrmonatige Reise vor sieben Jahren war eine Auszeit, wie man sie sich klassischerweise vorstellt und die dem Begriff auch gerecht wurde: Unsere Handys nutzten wir vor allem für die Buchung der Unterkünfte, während unsere E-Mail-Accounts ein automatisches Signal mit beabsichtigt ungenauem Rückkehrdatum feuerten.
Als wir vor mittlerweile drei Jahren mit der Planung dieser Reise begannen, war von Anfang an klar, dass es sich nicht erneut um eine Auszeit im klassischen Sinne handeln würde. Wir waren mittlerweile beide selbstständig und wollten unsere beruflichen Aktivitäten nicht vollständig herunterfahren. Zudem würde dieses Mal unser Sohn die Reise massgeblich mitgestalten. So wollten wir einfach, entspannt und gut strukturiert neun Monate in einer weit entfernten englischsprachigen Stadt verbringen.
Und dann kam die Pandemie. Sie war für unsere Pläne gewissermassen Segen und Fluch: Sie verhinderte einerseits die Einreise in Neuseeland und brachte andererseits eine Verbesserung und breite gesellschaftliche Anwendung der nötigen Technologie, was die Fernarbeit plötzlich attraktiver und akzeptierter machte.
Raum, Zeit und Mittel.
Auch unter den üblichen alltäglichen Bedingungen gestalte ich mein Arbeitsumfeld konstant. Für gewisse Aufgabenstellungen tue ich dies sehr bewusst, zum Beispiel für die Kreation eines partizipativen Prozesses oder die Moderation einer Veranstaltung. Vieles im Arbeitsalltag passiert dann aber doch unbewusst, und grosse Veränderungen finden nur in kleinen Schritten statt.
Das Experiment mit der mobilen Fernarbeit war deshalb bereichernd, weil ich mir meine räumlichen, zeitlichen und technischen Bedürfnisse unter mobilen Rahmenbedingungen neu überlegen und sie dann auch an der Realität messen musste.
Für eine zweite Einordnung sei nun ergänzt, dass wir uns schliesslich für das Format eines Roadtrips durch Frankreich und Spanien entschieden, als klar wurde, dass Neuseeland seine Grenzen nicht mehr rechtzeitig öffnen würde. Wir besorgten uns zum ersten Mal in unserem Leben ein eigenes Auto auf Zeit und fuhren mit vollem Kofferraum los. Unser Plan: Kein festes Hauptquartier in einer uns bereits bekannten Stadt, sondern eine Reise mit vielen Zwischenquartieren und unbekanntem Ziel. Diese zwei Szenarien haben auf die Fernarbeit sehr unterschiedliche Auswirkungen.
Zeit: Den Spagat zwischen Verlässlichkeit und Flexibilität gemacht.
Beginnen wir mit dem Faktor Arbeitszeit. Während unserer Reise übernahm ich vor allem interne Aufgaben sowie die Co-Kreation von partizipativen Prozessen für unsere Kund*innen. Dazu war ein regelmässiger Austausch im Team unerlässlich. Um Planbarkeit zu garantieren, entschieden wir uns für einen fixen Arbeitstag pro Woche, was in der Regel gut funktionierte, in der Realität aber auch bedeutete, dass ich praktisch den ganzen Tag in Online-Sitzungen verbrachte. Zudem zeigte sich schnell, dass sich beispielsweise Akquise-Prozesse und vereinzelte externe Termine kaum an einen fixen Wochentag binden lassen. Und dass sich die Kreativität nicht an Bürozeiten hält, ist hinlänglich bekannt.
Deshalb war schlussendlich mehr Engagement und Flexibilität gefragt als ursprünglich geplant: Rückblickend liegt ein realistisches und inhaltlich auch befriedigendes Pensum eher bei 30–40% als bei den ursprünglich geplanten 20%. Der Mittwoch blieb zwar mein Fixpunkt, ich ergänzte ihn aber immer wieder mit einzelnen zusätzlichen Tages- und Nachtstunden am Monitor oder über dem Skizzenbuch.
Mittel: Auf Verlässlichkeit gesetzt.
Und damit zum Faktor der Arbeitsmittel. Auf der digitalen Seite führte ich nichts weiter als einen Mac, eine Maus, ein Mobiltelefon, ein Modem sowie die entsprechenden Kabel mit mir, auf der analogen Seite mein Skizzenbuch und meine Schreibutensilien. Mehr nicht. Ich hatte von Anfang an keinen Anspruch, mir neue Arbeitsmittel zu erschliessen, in der Annahme, dass mich das Experiment vor genügend andere Herausforderungen stellen würde.
Tatsächlich war es auch so, dass die notwendige kabellose Internetverbindung in den meisten französischen und spanischen Ferienwohnungen auch im Jahr 2022 noch alles andere als verlässlich ist. In mindestens zwei Drittel aller temporären Residenzen war die Verbindung just in denjenigen Räumen ungenügend, die sich zum Arbeiten einigermassen geeignet hätten. In einem Fall war die Netzverbindung von Anfang an inexistent, und es blieb entgegen allen Versprechungen dabei – die vollen zwei Wochen unseres Aufenthalts. In solchen Fällen wählte ich mich über mein Mobiltelefon auf die Datenautobahn ein, wobei sich die vorgängige Wahl eines Datenpakets von 40GB pro Monat bewährte.

Altbau-Ferienwohnung in Barcelona.
Raum: Auf viel Flexibilität gefasst sein.
Was den Faktor Arbeitsraum anbelangt, gingen meine Vorstellungen und die Realität am weitesten auseinander, und damit meine ich sowohl den physischen Werkraum als auch den psychologischen Denkraum. Die Vorstellung: Ich verabschiede mich von meiner Familie, setze mich ins Arbeitszimmer, fahre den Mac auf dem Arbeitstisch hoch und steige in die erste Online-Sitzung ein.
Die Realität: Ich verabschiede mich von meiner Familie und setzte mich auf das Bett im Schlafzimmer, das als einziger Raum abschliessbar und dadurch vom Familiengeschehen trennbar ist. Nachdem ich das Bett verrückt und einen Stuhl geholt habe, fahre ich den Mac auf meinem Schoss hoch und versuche in die erste Online-Sitzung einzusteigen. Ich mühe mich mit dem kabellosen Netz ab, bis ich mich über mein Telefon einlogge und feststelle, dass ich meinen Tee im Trubel des Familienfrühstücks in der Küche habe stehen lassen.
Das mag an den Lockdown erinnern, und somit an die Feststellung, dass die Arbeit in den eigenen vier Wänden immer mit Herausforderungen verbunden ist, zumindest kurzfristig oder in einer neuen, ungewohnten Umgebung – und das war bei uns im Durchschnitt alle zehn Tage der Fall.
Wir haben festgestellt, dass das Arbeiten in den gemeinschaftlichen Räumen wie Wohnzimmer oder Küche selten funktioniert, und die privaten Räume sind in der Typologie der westeuropäischen Ferienwohnung oft so knapp geschnitten, dass neben Bett und Nachttisch kaum noch ein Stuhl darin Platz findet. Und der Aussenbereich ist entgegen der gängigen Vorstellung ebenfalls nur selten zum Arbeiten geeignet: Wind, Kälte, Hitze oder Regen machten uns unerwartet oft einen Strich durch die Rechnung.

Tàrbena in Spanien.
Der Denkraum ist draussen.
Wie der Name schon sagt, sind Ferienwohnungen primär für Ferien gedacht. Trotzdem ist es rückblickend erstaunlich, wie wenige Angebote auf dem Markt die Fernarbeit in die Überlegungen einbeziehen. In seltenen Fällen ist eine Art Arbeitsecke vorhanden, noch seltener kann auf einschlägigen Portalen nach ebendieser Kategorie gesucht werden, und ganz selten eignet sich der beabsichtigte Bereich tatsächlich zum Arbeiten, schon gar nicht in der Konstellation einer Familie. Sehr gut gestaltet war die Arbeitsecke während der gesamten Reise eigentlich nur in «unserer» Altbauwohnung in Barcelona: Hier war der Kopfbereich des Betts auf kreative Art und Weise als Arbeitsecke ausgebildet.
Das wirft die Frage nach Ausweichmöglichkeiten auf, und auch diese waren nicht einfach zu finden: In der Gastronomie wird verständlicherweise Konsum vorausgesetzt, und Co-Working-Spaces waren gerade in kleineren Ortschaften inexistent. Und auch Co-Working-Spaces in grösseren Städten setzten oft auf das Konzept eines regelmässigen Besuchs, was mit unserem Format des Roadtrips wiederum nicht vereinbar war. So haben wir unsere Ansprüche an den physischen Arbeitsraum schon nach wenigen Ortswechseln korrigieren müssen: In der Regel blieb es bei einem Stuhl im Schlafzimmer. Als Ausgleich haben wir uns vermehrt abwechslungsreiche Denkräume gesucht und geschaffen: Ich selbst habe die Kreativphasen meistens joggend verbracht.

Experiment geglückt.
Aus unserer Sicht ist das Experiment Familienreise mit Teilzeit-Fernarbeit geglückt. Was ich persönlich daraus gelernt habe, ist in diesem letzten Kapitel zusammengefasst und auch gleich als Reminder für die Planung der nächsten Reise formuliert. Denn ja: Wir werden es wieder tun. Und bin gespannt, wie sich die Rahmenbedingungen bis dahin verändern werden.
- Es lohnt sich. Punkt.
- Eine Familienreise mit Teilzeit-Fernarbeit fühlt sich zwar wie Ferien an, der konstante Wechsel zwischen Reiseorganisation, Familienleben, Einzelbetreuung und beruflicher Tätigkeit ohne die Möglichkeit auf externe Kinderbetreuung ist aber anstrengend. Darum sind auch tatsächlich arbeitsfreie Wochen («Ferien») einzuplanen.
- Die Aufenthaltsorte sind mit Bedacht zu wählen. Grossstädte bieten zwar unzählige Übernachtungsmöglichkeiten und Attraktionen für die Familie, können aber auch schnell überfordern. Für uns haben sich Dörfer oder Städte mit 5’000 bis 20’000 Einwohner*innen mit einfachem Zugang zur Natur bewährt.
- Es lohnt sich, sich eine längere Zeit am gleichen Ort aufzuhalten, denn jeder neue Ort bedeutet eine neue Arbeitsumgebung, und viel wichtiger noch erfordert jeder neue Ort die Suche nach Spiel- und Skateplätzen, Märkten und Supermärkten, Restaurants, Stränden und Wanderwegen. Für uns haben sich zwei Wochen Dauer bewährt.
- Es lohnt sich, sich nicht so lange am gleichen Ort aufzuhalten, um sich zum gründlichen Putzen während des Aufenthalts genötigt zu sehen. Nicht selbst putzen zu müssen war für mich persönlich der grösste Luxus.
- Wir haben den Ortswechsel, wenn möglich, jeweils an einem Samstag vollzogen. So standen uns mehr Ferienwohnungen zur Verfügung, wir vermieden Feierabendverkehr und die Mitte der Woche blieb für die Arbeitstätigkeit frei.
- Wohnungen mit zwei Schlafzimmern haben uns genügend räumliche Flexibilität für unterschiedliche Bedürfnisse verschafft, wobei wir darauf achteten, dass mindestens ein Zimmer abschliessbar ist.
- Die Küche musste sowohl funktional sein als auch viel Aufenthaltsqualität bieten: Sie ist der Ort, an dem sich die Familie am meisten aufhält.
- Die Kinderbetreuung hatte in jedem Fall räumlichen Vorrang: Wer arbeitet, zieht sich zurück.
- Wohnungen und Häuser mit Garten respektive Erdgeschosszugang ermöglichten eine grössere Freiheit für unseren Sohn und somit auch für uns.
- Wir verliessen uns auf das Mobiltelefon, nicht auf lokale Netzwerke. Ein Abo mit 40GB Daten pro Monat hat sich für uns als ausreichend herausgestellt (eine Stunde Online-Sitzung benötigt rund 1GB Daten).